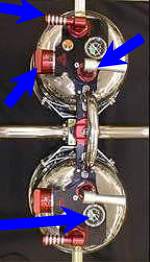Die Technik eines Heißluftballons
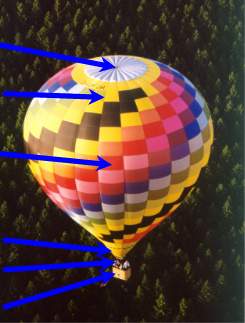
Der Parachute
Steigen erreicht man beim HL-Ballon durch weiteres Erwärmen der
Luft im Inneren des Ballons mittels des Brenners, Sinken leitet
man mit Hilfe des Parachutes ein. Der Parachute ist ein
Fallschirm, der nur durch Zentrierleinen und den Innendruck in der
Ballonhülle die obere Hüllenöffnung zudeckt. Über eine Leine,
die über zwei oder mehrere Umlenkrollen geführt wird, lässt
sich der Parachute ins Hülleninnere ziehen und es kann heiße
Luft ausströmen. Dadurch verliert der Ballon an Tragkraft und
beginnt zu sinken. Lässt man die Parachuteleine wieder los, wird
der Parachute durch den statischen Innendruck in der Ballonhülle
an die obere Hüllenöffnung gedrückt und in seine ursprüngliche
Ausgangsposition gebracht.
Zum Manövrieren soll der
Parachute nicht länger als 5 bis 10 Sekunden geöffnet werden.
Dabei reicht ein geringer Öffnungsspalt, um die gewünschte
Reaktion zu erhalten. Beim Aufrüsten des Ballons halten kleine
Felder mit Klettverschluss diesen in seiner Position. Vor dem
Start hat sich der Pilot von der Funktion des Parachutes zu überzeugen
und zieht diesen auf, bis sich alle Klettverschlüsse gelöst
haben.
Nach der Landung wird der Ballon über das Parachute -System
entleert.
Die Lastgurte
Als tragendes Gerippe werden Lastgurte in die Ballonhülle eingenäht,
die vertikal von der unteren Hüllenöffnung bis zum oberen Top führen.
Am Top enden die Lastgurte im sogenannten Kronenring. An der
unteren Hüllenöffnung sind die Lastgurte zu Schlaufen genäht,
in denen auf Kauschen die Tragseile, also die Verbindung zwischen
Hülle und Korb befestigt sind. Die Lastgurte übernehmen das
Gewicht von Korb und Insassen und sorgen dafür, dass die Last
nicht direkt in den Stoff eingeleitet wird.
Als Risstopper dienen horizontal aufgenähte Gurte (Bänder), die
ein Weiterreißen der Hüllenbahnen, z. B. nach einer Baumberührung,
über den Gurt hinaus verhindern sollen. Je nach Hüllengröße
werden mehrere dieser Rissstopper um den gesamten Umfang der
Ballonhülle entweder innen oder außen auf der Hülle aufgenäht.
Die Heißluftballon-Hüllen
Beim Heißluftballon wird der Auftrieb, durch heiße Luft erzeugt.
Die Hülle dient zum Umfassen dieser heißen Luft.
Größen
Das Volumen der gebräuchlichen HL-Ballone reicht vom 500 m3
Einmann-Ballon bis zum 12000 m3 Ballon, der in der Lage ist, mit
18 Personen aufzusteigen. Nach den Vorschriften der FAI (Fèdèration
Aèronautique International) werden Heißluftballone nach ihrem
Volumen in verschiedene Größenklassen eingeteilt. Dabei ist es
zulässig, dass der tatsächliche Rauminhalt um +/- 5% über der
Nenngröße liegt. Daraus ergeben sich folgende gebräuchlichen
Ballongrößen:
Ballon-GrössenDas Volumen (Nenninhalt) der
Heissluft-Ballone reicht Nach den Vorschriften der FAI Daraus ergeben sich die nebenstehend |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoff der Ballonhüllen
Man benutzt beim heutigen HL-Ballon Stoff aus dünnem und reißfestem
Nylon, der einseitig mit Polyuhrethan beschichtet ist, um genügende
Dichtigkeit zu gewährleisten. Dieser Stoff ist sehr leicht im
Gewicht (6Og/m2) und hitzebeständig.
Für den oberen und damit der größten Hitze ausgesetztem Bereich der Ballon-Hülle bieten die Hersteller auch Stoffe mit Silikonbeschichtung an. Diese sind schwerer als die polyuhrethanbeschichteten Stoffe (80g/m2), verlängern aber aufgrund der höheren Temperaturbeständigkeit die Lebensdauer der Ballonhülle. Je nach Hersteller haben diese Stoffe verschiedene Namen, z. B. Thermo - Grip, Hyperlast etc. Aufgrund der Silikonbeschichtung ist es nur schwer möglich, auf diese Stoffe ein Artwork aufzuspritzen.
Im unteren Bereich der Ballonhülle verwendet man eine rundumlaufende Bahn Nomex - Stoff. Dieser Stoff ist extrem hitzebeständig und sehr schwer entflammbar. Wird die Flamme des Ballonbrenners doch einmal auf diesen Teil der Ballonhülle gelenkt, verbrennt der Stoff zwar, verlischt jedoch nach dem Schließen des Brennerventils sofort wieder. Alle Hüllenstoffe sind in vielen Farben lieferbar, Sonderfarben müssen nach Absprache mit dem Ballonhersteller gesondert bestellt werden.
Konfektion
Je nach Hersteller gibt es verschiedene Hüllentypen von 8 bis 32
Bahnen. Die einzelnen Bahnen werden aus mehreren Einzelsegmenten
zusammengenäht. Aus je mehr Bahnen eine Ballonhülle gefertigt
wird, um so glatter wird ihre Oberfläche. Besteht die Ballonhülle
nur aus 8 oder 12 Bahnen, sind die einzelnen Bahnen sehr gebaucht.
Ballonhüllen mit wenigen Bahnen sind leichter im Vergleich zu
Ballonhüllen mit vielen Bahnen bei gleichem Volumen, da hier
weniger Lastgurte aufgenäht werden. Die meisten Hersteller bieten
diese Ballonhüllen auch günstiger an als vielbahnige Ballonhüllen.
Ballone mit vielen Bahnen jedoch eignen sich besser für
aufwendiges Artwork und Werbeaufschriften. Reparaturen bei denen
ganze Felder ausgewechselt werden müssen, sind bei vielbahnigen
Ballonen meist günstiger, da hier weniger Stoff benötigt wird.
Der Scoop bzw. die Schürze
An der unteren Hüllenöffnung befindet sich der Scoop bzw. die
Schürze. Diese bestehen aus Nomex - Stoff und dienen 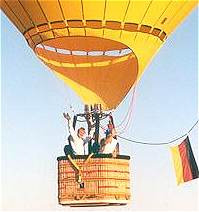 bei Wind als
Aufrüsthilfe. Sie sorgen dafür, dass die Brennerflamme bzw. die Wärme durch
den Wind nicht zur Seite abgelenkt werden oder beim am Boden
stehenden Ballon die Pilotflamme auslöschen. Der Scoop ist ein
dreieckiges Stück Stoff, dass nur knapp die Hälfte der Hüllenöffnung
umfasst, die Schürze ist rundumlaufend.
bei Wind als
Aufrüsthilfe. Sie sorgen dafür, dass die Brennerflamme bzw. die Wärme durch
den Wind nicht zur Seite abgelenkt werden oder beim am Boden
stehenden Ballon die Pilotflamme auslöschen. Der Scoop ist ein
dreieckiges Stück Stoff, dass nur knapp die Hälfte der Hüllenöffnung
umfasst, die Schürze ist rundumlaufend.
Der Brenner
Erhitzt wird die Luft heutzutage nicht mehr wie zu Zeiten der
Montgolfiers durch ein Strohfeuer, sondern durch  sehrleistungsstarke Brenner, die mit Propangas gespeist werden. Der
Brenner ist im Brennerrahmen kardanisch aufgehängt, d. h. er ist
in gewissem Maße schwenkbar, damit der Ballonführer immer in die
Hüllenöffnung zielen kann.
sehrleistungsstarke Brenner, die mit Propangas gespeist werden. Der
Brenner ist im Brennerrahmen kardanisch aufgehängt, d. h. er ist
in gewissem Maße schwenkbar, damit der Ballonführer immer in die
Hüllenöffnung zielen kann.
Brennerstützen
Der Brennerrahmen wird durch Brennerstützen in Position gehalten.
Diese werden zum Schutz vor Verletzungen der Korbinsassen mit
Polstern überzogen. Die Polster dienen zugleich zum Schutz vor
Beschädigung der Brennerschläuche und der Korbleinen, die
ebenfalls unter der Polster verlaufen.
Hauptbrenner
Durch den natürlichen Gasdruck in den Vorratsflaschen wird das
Flüssiggas über ein Tauchrohr und die Brennerschläuche in den
Brenner geführt. Dort gelangt es über Verdampferrohre in
Spiralform zu den Ausströmdüsen. Das Flüssiggas wird in den
Verdampferrohren durch die Flamme erwärmt. Über ein
Regulierungsventil wird nach Bedarf das Flüssiggas dosiert und
nach dem Düsenaustritt von einer Pilotflamme gezündet. Es gibt
Brenner mit wenigen Brennerdüsen mit einer oder mehreren
Bohrungen, bis hin zu Brennern die als Brennerdüsen viele
Bohrungen in einer Ringleitung verwenden. Je mehr kleine
Ausströmdüsen ein Brenner hat, um so leiser arbeitet er. Die
Flamme ist jedoch nicht mehr so kräftig und stabil, was beim
Aufrüsten bei Wind ein Nachteil sein kann. Auf der
Brennerunterseite und damit für den Freiballonführer
ersichtlich, befindet sich ein in das Gassystem eingebundenes
Manometer, das den Druck im Gassystem anzeigt. Es gibt je nach
Ballongröße Einzel- bis Vierfachbrenner. Beim üblichen
Sportballon mit einem Inhalt von 3000 m³ verwendet man einen
Doppelbrenner, Ballone für den gewerblichen Gästetransport mit
6000 m³ haben normalerweise einen Dreifach-Brenner. Die Leistung
eines Einzelbrenners beträgt ca. 2200 - 3000 KW.
wenigen Brennerdüsen mit einer oder mehreren
Bohrungen, bis hin zu Brennern die als Brennerdüsen viele
Bohrungen in einer Ringleitung verwenden. Je mehr kleine
Ausströmdüsen ein Brenner hat, um so leiser arbeitet er. Die
Flamme ist jedoch nicht mehr so kräftig und stabil, was beim
Aufrüsten bei Wind ein Nachteil sein kann. Auf der
Brennerunterseite und damit für den Freiballonführer
ersichtlich, befindet sich ein in das Gassystem eingebundenes
Manometer, das den Druck im Gassystem anzeigt. Es gibt je nach
Ballongröße Einzel- bis Vierfachbrenner. Beim üblichen
Sportballon mit einem Inhalt von 3000 m³ verwendet man einen
Doppelbrenner, Ballone für den gewerblichen Gästetransport mit
6000 m³ haben normalerweise einen Dreifach-Brenner. Die Leistung
eines Einzelbrenners beträgt ca. 2200 - 3000 KW.
|
Das "Kuhbrenner" Ventil |
|
Das Haupt Fahrventil |
|
Das Pilotflammen Ventil |
Jeder Brenner wird unabhängig vom anderen betrieben. Fällt also einmal ein Brennersystem während der Fahrt aus, kann mit dem oder den anderen Brennern die Fahrt sicher zu Ende gebracht werden. |
|
|
Der Lindstrand Doppelbrenner |
||
|
Das Manometer für den Gasdruck |
Die Leistung eines Brenners reicht üblicherweise für den
normalen Fahrbetrieb vollkommen aus, so dass der Pilot den
Mehrfachbrenner nur in Ausnahmefällen (z. B. hohe
Fallgeschwindigkeit durch Turbulenzen) wirklich benötigt. Evtl. können
zwei Brenner über ein Ventil zusammengeschaltet werden, um z. B.  beide gleichzeitig aus einem Gaszylinder betreiben zu können.
beide gleichzeitig aus einem Gaszylinder betreiben zu können.
Pilotbrenner
Die Zündung des Hauptbrenners erfolgt mit der Zündflamme des
Pilotbrenners. Dieser wird nach dem Bunsen-Prinzip aus der
Gasphase, also aus dem Gaspolster im oberen Teil der Gasflaschen,
gespeist und ist ständig in Betrieb. Über ein Druckminderventil
wird die Stärke der Pilotflamme stabil gehalten. Die Pilotflamme
ist durch einen Glühstrumpf aus hochhitzebeständigem Stahl
geschützt und brennt dadurch sehr sicher. Auch bei Unterbrechung
der Gaszufuhr von ca. 1 Sekunde Dauer zündet die Flamme durch den
Glühkopf selbständig wieder. Jeder Brenner besitzt seinen
eigenen Pilotbrenner, der während der Betriebsdauer ständig in
Funktion ist.
Kuhbrenner
Viele Hersteller haben in ihre Brennersysteme einen
"Kuhbrenner" integriert. Dieser ist leiser als der
normale Hauptbrenner und auch der bei manchen Brennern typische
Anfangsknall beim Betätigen des Fahrventils entfällt. Dieser
Brenner sollte beim tiefen Fahren über Tierherden oder
menschlichen Siedlungen verwendet werden. Leider ist die Flamme
dieser Brenner sehr instabil und mit Ruß durchsetzt, so dass der
Kuhbrenner für den normalen Fahrtbetrieb ungeeignet ist.
 |
Der Korb dient der Aufnahme von Insassen, und der notwendigen Gasflaschen und Gerätschaften. Er ist allerdings in Form, Konstruktion und Wahl des Materials sehr traditionsgebunden. In der Tat bietet sich bis dato kein geeigneteres Material für die Korbwände als natürlich gewachsenes Geflechtwerk wie Peddingrohr, Weiden oder ähnliches an. Diese geflochtenen Körbe lassen sich nicht durch Plastik- oder Aluminiumkonstruktionen ersetzen, da nur das Flechtwerk bei härteren Landungen nachgibt, den Schwung des Aufpralls dämpft und trotzdem sehr widerstandsfähig ist. |
 |
Aufbau des Korbes
Der Boden des Korbes ist entweder geflochten oder besteht aus
einem kräftigen Holzrahmen, der direkt mit den Flechtwänden
verbunden ist. Der untere Teil des Geflechts ist abgerundet und
mit Leder überzogen .Der obere Teil der Flechtwände ist zum
sicheren Schutz der Insassen bei Schleiflandungen nach innen
eingezogen. Die Brüstung ist ve rsteift, gepolstert und mit
Naturleder überzogen. Zur Verstärkung des Korbes
sind je nach Korbgröße 2 oder mehr alulegierte Rohre in den Wänden
eingeflochten, die durch den Korbboden führen. Diese Rohre dienen
zugleich zur Führung und zum Schutz gegen mechanische Beschädigung
der Korbseile, die den Korb mit dem Brenner und der Hülle
verbinden.
rsteift, gepolstert und mit
Naturleder überzogen. Zur Verstärkung des Korbes
sind je nach Korbgröße 2 oder mehr alulegierte Rohre in den Wänden
eingeflochten, die durch den Korbboden führen. Diese Rohre dienen
zugleich zur Führung und zum Schutz gegen mechanische Beschädigung
der Korbseile, die den Korb mit dem Brenner und der Hülle
verbinden.
Der
Ballonpilot hat einige Instrumente bzw. Hilfsmittel an Bord, die ihm die
Navigation und die Anweisungen für das Verfolgerteam erleichtern sollen.
Zur sicheren Durchführung von Ballonfahrten ist mindestens ein Funkgerät,
ein Höhenmesser mit einer integrierten Steig - Sinkanzeige (Variometer)
und ein Hüllentemperaturmesser vorgeschrieben.
Hier die Wichtigsten:
Landkarten im Maßstab 1:50.000 oder 1:100.000.
Wichtig ist, dass der Pilot und der Verfolger die gleichen Kartenmaßstäbe
haben.
Variometer mit Höhenmesser und Temperaturanzeige:
 |
Anzeige,
ob man steigt oder fällt, die Höhenanzeigen über NN und die Hüllentemperatur
ganz oben. |
 |
Global
Position System (GPS):
Ein Kompass zur Navigation sollte auch mitgeführt werden, wobei dieser in jüngster Zeit zusehends vom GPS-Gerät (Global-Positioning-System) verdrängt wird. Über Satelliten wird die exakte Position ermittelt. Das GPS zeigt aber auch die ganz wichtigen Angaben - die Anzeige der Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung in Grad. Dies hilft ihm dann, seine "Erdferkel" richtig vorauszuschicken. |
Fernglas:
Um zu prüfen, ist die vorgesehene Landewiese wirklich eine Wiese oder
doch ein Feld?
Was steht auf dem Ortsschild da unten?
|
Funkgerät:
Die
meisten Funkgeräte verfügen über 760 Kanäle im 25 Kilohertz -
Raster. |
|
www.Ballonteam-Sauerland.de |